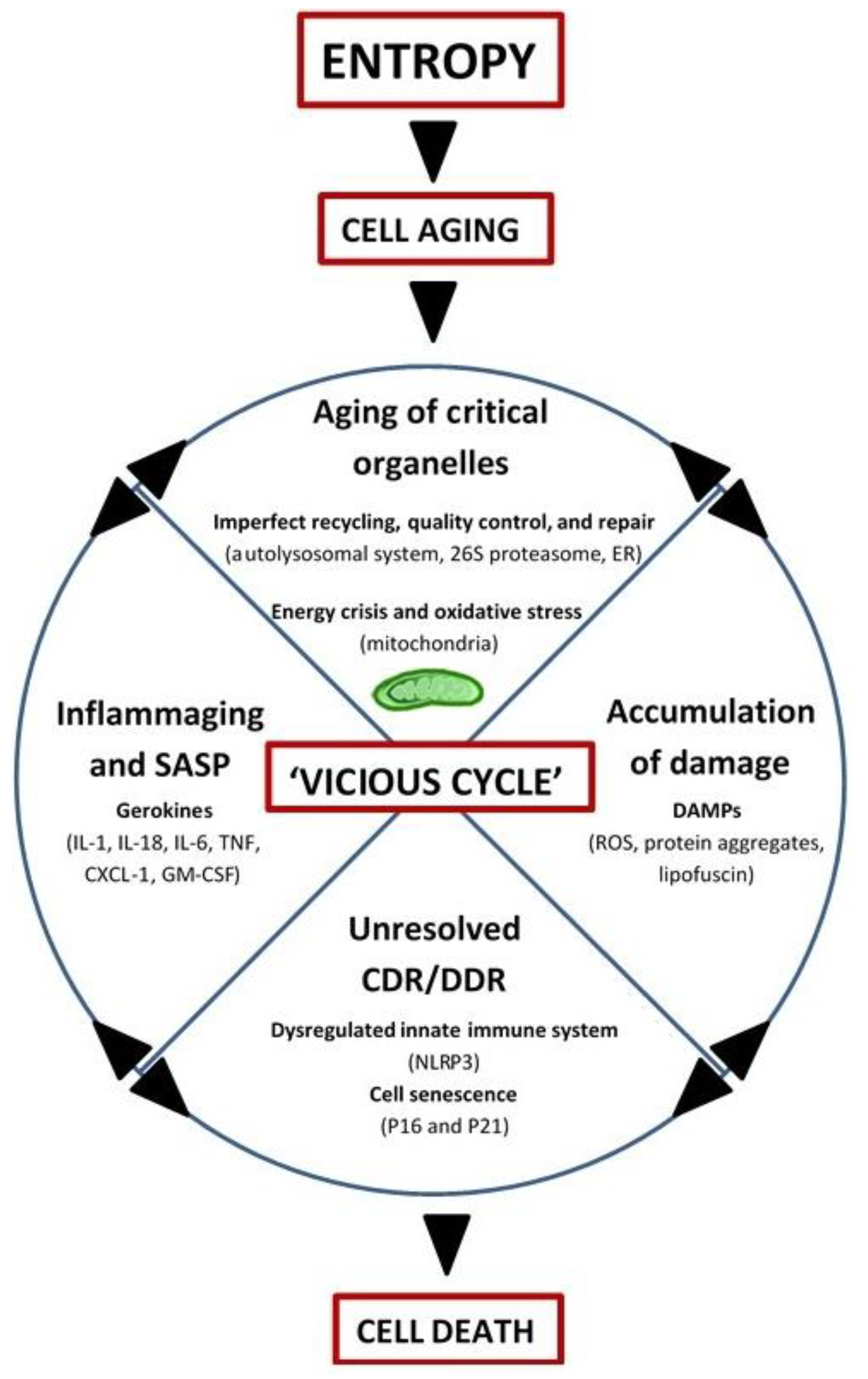Forum für Lebensverlängerung
»
Radikale Lebensverlängerung, Sport, Verschiedenes
»
Verschiedenes
»
Mitochondrien
Forum für Lebensverlängerung
»
Radikale Lebensverlängerung, Sport, Verschiedenes
»
Verschiedenes
»
Mitochondrien


|
|
Mitochondria and Aging—The Role of Exercise as a Countermeasure
Dr.Faust sagt danke
|

|
|
Kennt jemand dieses Buch und kann es empfehlen? |

|
|
#153 Ich hab das Buich nicht, habe mal gerade die Kommentare gelesen. Man müsste
Julie sagt danke
|

|
|
Mitochondrien: Doch nicht unabhängig vom Zellkern? Zitat
parcel und Prometheus haben sich bedankt!
|

|
|
Mitochondria and Aging—The Role of Exercise as a Countermeasure |

|
|
Zitat von Speedy im Beitrag #149 Ich habe nun mal testweise eine 3 wöchige Kur damit gemacht. Also eine Packung bestellt und vollständig aufgebraucht. Die Hauptnebenwirkung ist ja Durchfall, die allerdings bei mir völlig ausblieb. Mir ist aufgefallen wenn ich die Einnahme in den Abend verlege dies meine Schlafqualität eher negativ beeinflusst. Ansonsten habe ich weder positive noch negative Effekte bemerkt. Einen leichten Anstieg der Libido vielleicht. |

|
|
Hallo, |

|
|
Mit diesen ganzen Supps induziert man möglw. auch den bisher wenig thematisierten reduktiven Stress.
parcel, mithut und Prometheus haben sich bedankt!
|

|
|
Zitat von Fichtennadel im Beitrag #159 Oxidativer Stress ist ein Messenger in den Mitos....: https://hcfricke.com/2019/01/09/buchkrit...on-lee-know-nd/ Zitat
|

|
|
Über die Verbindung der Mitochondrien durch Nano-Tunnel:
Prometheus und mithut haben sich bedankt!
|

|
|
|

|
jayjay
(
gelöscht
)

|
. |

|
|
Methylene Blue (MB) May Allow Creating Near-perfect (redox) Batteries
Prometheus sagt danke
|

|
|
Zitat von Fichtennadel im Beitrag #164 Mir ist noch nicht ganz so klar wie uns diese Erkenntnis nun weiter bringt bzgl. der Mitochondrien. |

|
|
@Speedy |

|
|
|

|
|
The Good and the Bad of Mitochondrial Breakups
La_Croix sagt danke
|

|
|
Mitochondrien funktionieren ähnlich wie moderne Akkus in Elektroautos
parcel und Prometheus haben sich bedankt!
|

|
|
Sauerstoffmangel programmiert Mitochondrien um Zitat
Tizian und Prometheus haben sich bedankt!
|

|
|
|

|
|
Gene discovery in fruit flies could help search for new treatments for mitochondrial disease
La_Croix sagt danke
|

|
|
Late-life restoration of mitochondrial function reverses cardiac dysfunction in old mice
La_Croix sagt danke
|

|
|
Kynurenine pathway, NAD+ synthesis, and mitochondrial function: Targeting tryptophan metabolism to promote longevity and healthspan.
Prometheus, mithut und La_Croix haben sich bedankt!
|

|
|
Aging Likely Caused By Decreased Respiration / Metabolism, Not Genetic Mutations |

 Thema drucken
Thema drucken 18.05.2019 03:32
18.05.2019 03:32

 Antworten
Antworten